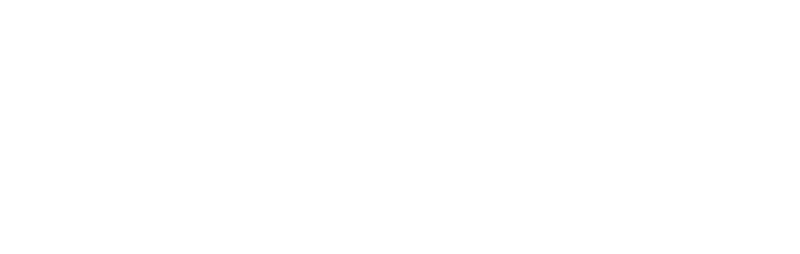Asiatische Glasperlen? Eine kritische Untersuchung der „fernöstlichen Mystik“ in Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ von Sebastian Giebenrath
Meldung vom 17.05.2010


Den Reiz orientalischer, bzw. fernöstlicher Dichtung und Weltschau haben – Hesse sehr wohl bewusst – schon Goethe (West-östlicher Diwan!) und Platen in eigener Dichtung eingeschmolzen; die von Klabund (philologisch vielleicht anfechtbar) vorgenommene Nachdichtung altchinesischer Gedichte (darunter das berühmte „Lied von der Pfauenfeder“ von Li-tai-po) hat Hesse nachweislich gekannt und gelobt; die fernöstlich inspirierten Erzählungen von Max Dauthendey („Die acht Gesichter vom Biwa-see“) gefielen Hesse ebenfalls, und nicht nur, weil er den Dichter selbst kannte. Die altindischen Quellen sind eben nicht nur vermutet, wie häufiger geglaubt wird, sondern sie sind nachweisbar, wie sämtlichen Literaturrezensionen Hesses (Bde. 16 – 20 der neuen Gesamtausgabe) zu entnehmen ist. Darin steht unter anderem auch, dass es ihm (Hesse) immer wieder große Freude bereitet, in den ihm vorliegenden und ihm zur Beurteilung zugeschickten Bildbänden zu blättern, die Landschaften und Menschen aus den fernöstlichen Regionen zeigen. Hesse gerät förmlich ins Schwärmen in seinen gedruckten (und deshalb zugänglichen) Rezensionen über die „herrlichen“ dickleibigen Bildbände. Vor allem aber kannte und schätzte Hesse von Jugend an die Bhagvad-gita, die Upanishaden, das Ramanayana und viele vedische Schriften, zu deren Lektüre ihn auch sein Großvater, der bedeutende Indologe Hermann Gundert, angeregt hatte. Wohl hat Hesses Vater Johannes eine Studie über das „Tao-te-king“ verfasst, die von dem chinesischstämmigen Germanistikprofessor Adrian Hsia in „Hermann Hesse und China“ auch angeführt wird. Doch Hsia hat das „Glasperlenspiel“ offensichtlich etwas ungenau gelesen, sonst wären ihm auch die starken konfuzianischen Bezüge aufgefallen. Doch Hsia versteift sich, wie andere Sinologen ebenfalls, auf die vorgebliche taoistische Dominanz. Wiewohl Hesse in dem Roman gerade ein halbes Dutzend Mal das „I Ging“ erwähnt, schreibt Hsia: „Die Analogie zwischen dem Glasperlenspiel und dem System des „I-Ging“, aus dem auch das Schema des Hausbaus abgeleitet wurde, ist offensichtlich.....In der Tat scheint das Glasperlenspiel eine modifizierte Version des I-Ging-Systems zu sein.“ Eine kühne Behauptung, die bei genauer Analyse des „Glasperlenspiels“ einfach nicht haltbar ist. Völlig daneben liegt Hsia mit seiner sinozentrischen Betrachtungsweise, wenn er einen Gegensatz konstruieren will zwischen den diversen Begriffsinhalten der chinesischen Schriftzeichen und den im europäischen Raum gebräuchlichen Buchstaben und Schriften. Hsia reklamiert (durchaus zu Recht) die semiotische Vielfalt der chinesischen Zeichen, stellt sie aber als so einzigartig da, als hätten sie Hesse – der weder chinesisch lesen noch schreiben konnte – derart tief beeindruckt, dass er diese Zeichensysteme dem „Glasperlenspiel“ inkorporiert hätte. Das konnte Hesse gar nicht leisten, denn wie sollen Zeichensysteme Anwendung finden, deren Bedeutung unbekannt ist? Dieses Kunststück wollen esoterisch angehauchte Hesse-Jünger damit erklären, es sei ein allgemein mystischer Geist, der solches zustande bringe. Die Lösung für das Rätsel ist eigentlich ziemlich einfach, wenn wir – wie Hesse – uns mit den sprachmystischen Überlegungen in Europa beschäftigen. Da ist zunächst einmal der Humanist Johannes Reuchlin („de verbo mirifico“), auf dessen Spekulationen über das (hebräische) „Originalwort Gottes“ dann die tiefsinnige und sehr anspruchsvolle Sprachmystik von Jakob Böhme beruht. Ähnlich wie es Hsia für die chinesischen Schriftzeichen schildert, hat Böhme ein System entwickelt, das jedem Buchstaben eine ganze Reihe Eigenschaften zuordnet wie „rot“, „feucht“, „Himmel“, „kalt“, „Wind“, „Engel“ etc. Aber Böhme beschränkt sich nicht auf den einzelnen Buchstaben in einem Wort, sondern entwirft eine Kombinatorik mit den jeweils den benachbarten Buchstaben zugeordneten Eigenschaften. So entstehen völlig neue Eigenschaften, die letztlich für den Leser den Zugang schaffen sollen zur Erkenntnis Gottes. Böhme hat dabei nicht nur das hebräisch geschriebene „abba adonai“ als signifikantes Beispiel herangezogen, sondern seinem System eine universelle Geltung zugeschrieben – auch für die von ihm und uns gewöhnlicherweise benutzten lateinischen Buchstaben. Im vierten, dem sogenannten schwäbischen Lebenslauf des Josef Knecht – ursprünglich für das „Glasperlenspiel“ vorgesehen und in zwei Fassungen vorhanden – wird Tübinger Theologiestudenten ausdrücklich die Böhme-Lektüre empfohlen. Schon in seiner Kindheit wurde Hesse mit der kabbalistischen Lehrtafel „Turris Antonia“ bekannt, die in der evangelischen Kirche von Bad Teinach steht, unweit von Calw, und die auch immer noch alljährlich Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt ist. Diese riesige Lehrtafel (ein Ölgemälde mit zwei vorgesetzten, ebenfalls gemalten Flügeln) wurde eigens geschaffen für die hochgebildete, sich intensiv mit kabbalistischer Mystik beschäftigende Prinzessin Antonia von Württemberg, die auch die Vorgaben zu den Darstellungen lieferte. Prinzessin Antonia war die Schülerin von Johann Valentin Andreae, der nicht nur der Verfasser der bedeutenden Sozialutopie „Christianopolis“ ist, sondern sich auch intensiv mit Böhme und der jüdischen Kabbala auseinandergesetzt hatte. Zu Hesses frühzeitiger Kenntnis dieser Tafel siehe auch „Kindheit und Jugend“ (Suhrkamp-Taschenbuch), sowie „Hermann Hesse – Jugend in Calw“ von Siegfried Greiner. Über Inhalt und Bedeutung der „Turris Antonia“ liegt inzwischen ein umfangreiches wissenschaftliches Standardwerk vor. Gewiss lässt sich Alles in Allem sehen. Somit können auch formale Ähnlichkeiten in sonst unterschiedlichen Kulturen auf einen Nenner gebracht werden. Selbst von Kulturen, die keinerlei geographische Berührungspunkte jemals hatten. Allerdings warnte schon Carl Jacob Burckhardt (eines der Vorbilder für den Pater Jakobus im „Glasperlenspiel“) in „Die Zeit Constantin des Großen“ vor diesem – so wörtlich – Unsinn. Es bleibe jedem überlassen, inwieweit er die solchen Similareffekten zugrunde liegenden C.G.Jung’sche Theorie vom „Kollektiven Unbewussten“ als tatsächliche Gegebenheit glauben will. Glauben, wohlgemerkt! So kann Adrian Hsia eben „durchaus 'chinesisches' erblicken, wo zunächst an der Oberfläche andere lokale oder kulturelle Traditionen vorliegen, aber natürlich kann es sich im einzelnen auch um eine Projektion handeln...“ Die Sinologisierung jener europäischen Kulturtraditionen, aus denen Hesse vor allem sein Wissen schöpfte (das dann auch im „Glasperlenspiel“ weit mehr ist als eine Petitesse), mag ja manchen Schwarmgeistern imponieren, die auf Hesses angeblich fernöstliche Mystik zu insistieren nicht müde werden. Aber 1. tun sie damit sich selbst keinen Gefallen, weil Ahnungslosigkeit schon immer ein schlechter Ratgeber war, und 2. stellen sie Hesse genau in jene esoterikschwangere Ecke, die ihn (sehr zu seinem lebenslang geäußerten Ärger übrigens) als Spintisierer und Mystagogen erscheinen lässt. Wenn wir den größten deutschen Mystiker, Meister Eckardt, heranziehen, dann ließe sich in seinem Sinne formulieren, dass ja die Seele Gottes (anima dei) in allen belebten und unbelebten Teilen sei, und diese Teile nach der mystischen Vereinigung (unio mystica) mit Gott strebten, somit alles in allem enthalten sei. Diese pantheistisch gefärbte Sicht hat Eckardt, nebenbei gesagt, einen Ketzerprozeß eingehandelt. Das „Glasperlenspiel“ ist – von seiner eminent politischen Zielrichtung einmal abgesehen – ganz sicherlich KEIN Mysterienspiel, sondern ein intellektuelles Bravourstück, das virtuos mit Bildungsgütern aus aller Welt jongliert. Ein kontrapunktisches und kontrapunktisch angelegtes Meisterstück, das seine musikalischen, sprachhistorischen und monastischen Vorbilder aus der europäischen Geistesgeschichte keinen Moment verleugnet, zugleich aber die parallel entwickelten geistigen Errungenschaften fernöstlicher Kulturen als „Spielmaterial“ einbezieht. Es gehört ein gerütteltes Maß an exzellenter Allgemeinbildung dazu, aber ganz gewiss keine mystische Erfahrung, um Hesses „Glasperlenspiel“ als das zu goutieren, was ihm die weltweite Bewunderung (auch seiner Schriftstellerkollegen) und letztlich den Nobelpreis eingebracht hat: das schwindelerregende Spiel mit dem Intellekt, das zugleich Dichtung ist Ganz und gar nicht „asiatisch“ nimmt sich ein weiterer Gesichtspunkt aus. Im Vorwort zum „Glasperlenspiel“ schreibt Hesse, dass „der Erfinder Bastian Perrot aus Calw sich anstelle von Buchstaben, Zahlen, Musiknoten oder anderer graphischer Zeichen dieser Glasperlen zu seinem Spiel bediente.“ Hintergrund dazu ist Heinrich Perrot, Waldenserabkömmling und Hesses Lehrherr während der Mechanikerlehre (siehe auch „Unterm Rad“), den Hesse letztmalig im Herbst 1925 besuchte und dabei von Perrot in „unerbittlich langen Ausführungen“ mit dessen selbstkonstruiertem Glockenspiel vertraut gemacht worden ist. Da Perrot keine Noten weder lesen noch schreiben konnte, hatte er eigene Zeichen erfunden, die außer ihm niemand verstand. Die von ihm erfundenen Melodien, Tonlängen, Wiederholungen, Tempi und Doppeltöne schrieb er in dieser Geheimschrift auf.(vgl. dazu: Heinrich Perrot, „der Grübler“, Erinnerungen an meinen Vater, mit Zeichnungen aus dem Archiv der Familie Perrot, Altensteig/Calw 1970). Das manchmal etwas geringschätzige Abtun von Hesses Erzählungen hätte diesem absolut nicht geschmeckt. Er hat sich häufig in Briefen (u.a. an Thomas Mann) darüber beschwert, dass er „nur“ nach seinen „großen Werken“ beurteilt würde. Bei Hesse zu behaupten, Selbstironie sei „bei seinen Helden aber so gut wie nie“ zu finden und das „chinesisch beeinflusste Glasperlenspiel“ gänzlich „humorlos“ - das ist zwar gängige Münze in Germanistenkreisen, lässt aber bestenfalls auf einen erschreckenden Mangel an Kenntnis von Hesses Gesamtwerk schließen. Über die „Einsicht in höhere spirituelle Wirklichkeiten“, die viele Mystifizierer in Hesses literarischem Schaffen entdeckt haben wollen, hätte dieser nur belustigt gegrinst und wieder einmal einen seiner Briefe geschrieben, in denen er gegen die mystische Vereinnahmung seines literarischen Werkes wettert. Auch Briefe sollten in toto gelesen werden von denen, die das „rührend Märchenhafte“ (Günter Eich) der „Morgenlandfahrt“ für dogmatischen Mystizismus halten.