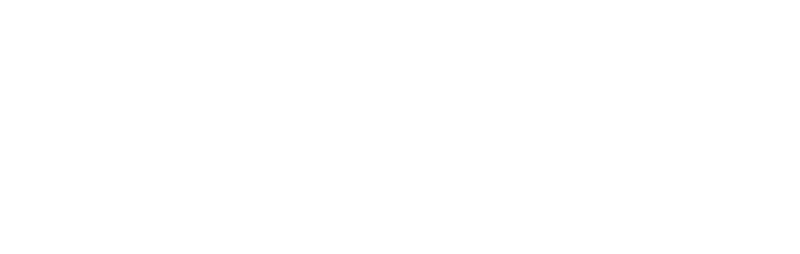Hermann Hesse und sein Elternhaus – zwischen Rebellion und Liebe
Meldung vom 23.11.2009


„In manchen Darstellungen über Hesses Elternhaus“, so Matthias Hilbert, „kommt es … zu Bewertungen und Unterstellungen, die fast schon an einen postmortalen Rufmord der Eltern grenzen“ (S. 271 f. Anm. 118). Da werden die Eltern als „verständnislos“ dargestellt, von einem „religiösen Wahn“ besessen, die den traumatisierten Sohn „bis zum Teufelsaustreiber, in die Nervenheilanstalt und zum Selbstmordversuch“ getrieben hätten. Ein tradiertes Vorurteil über „die pietistische Erziehung“ steht offenbar von vornherein fest und muss nur noch mit tiefenpsychologischem Vokabular ausgefüllt werden. Anders die Darstellung Hilberts. Aus den Quellen gearbeitet, kann sie die genannten Deutungsmuster nicht übernehmen, ist aber auch keine bemühte elterliche Apologetik. Hilbert stützt sich auf autobiographische Äußerungen des 1877 geborenen Hermann Hesse in Werken und Briefen, auf Tagebuchaufzeichnungen der Mutter und Briefe des Vaters und Großvaters. Er weiß um ein gründliches Quellenstudium als bestes Heilmittel gegen die unkontrollierte Verwendung „schlagender“ Begriffe. Auf diese Weise wird die pietistische Herkunft von Hesses Eltern und Großeltern dargestellt (S. 11–64), zusammengefasst im Abschnitt „Die pietistische Welt des Elternhauses“ (S. 65–79). Ein eigenes Kapitel ist Hermanns Kindheit gewidmet (S. 80–109), bevor der Abschnitt „Die große Pubertätskrise“ (S. 110–183) den Ereignissen im Maulbronner Seminar, bei Christoph Blumhardt in Bad Boll, in der Heil- und Pflegeanstalt Stetten, bei Jakob Pfisterer in Basel und auf dem Cannstatter Gymnasium nachgeht. Das Ende der Krise markiert Hesses Buchhändlerlehre im Tübinger Antiquariat Heckenhauer (S. 184–220). Hesses Reflexionen über die Bedeutung des väterlichen und mütterlichen Erbes für seine Persönlichkeitsentwicklung und Hinweise auf seine lebenslange „Suche nach Ganzheit“ (S. 221–250) schließen das Buch ab. Der umfangreiche Anmerkungsteil (S. 251–4287) ist lesbar und wegen seiner Exkurse und ausführlichen Zitate auch lesenswert. Hilbert lädt den Leser nicht zu einem Rundflug ein, der einen vermeintlichen Überblick gewinnt, indem er Höhen und Tiefen, Ecken und Kanten der handelnden Personen einebnet. Stattdessen animiert er ihn zu einer Begegnung auf Augenhöhe, etwa mit Hesses Großmutter Julie Gundert geb. Dubois, einer französischen, die Praxis pietatis übenden Calvinistin. Sie organisiert Betstunden, speist Arme und pflegt Kranke, hat aber für die ihr zugedachte Rolle als Hausfrau nur den rebellischen und hoffnungsvollen Seufzer übrig: „O, im Himmel man koch nicht mehr, man wasch nicht mehr und putz nicht mehr!“ Ihren Mann Hermann Gundert, den in Indien hoch angesehenen Missionar, Linguisten und Volkskundler, der 1862 die Leitung des Calwer Verlagsvereins übernimmt, hat der Enkel Hermann Hesse zeitlebens verehrt. Eine Begegnung auf Augenhöhe auch mit Christoph Blumhardt in Bad Boll (1892), dem angeblichen „Teufelsaustreiber“, der in seinen Briefen und in Äußerungen Hermanns und der Eltern zu Wort kommt (S. 122–126 mit Anm. 99. 100). Tradierte Vorurteile zerbrechen. Nachdenklich macht auch die im Tagebuch von Hesses Mutter beschriebene Gebetsheilung ihrer schmerzhaften Knochenerkrankung (1896), eingetreten nach einem Gebet des Evangelisten Elias Schrenk. Hermann Hesse reagiert erschüttert und glücklich (S. 200–203). Der Leser wird mit der Krise des Sohnes und dessen verzweifelter Suche, dann mit der Hilflosigkeit der Eltern konfrontiert, mit den Zeiten des Aneinandervorbei-Redens, die doch Zeiten gegenseitiger Liebe bleiben. Hermanns Vorwurf kommt zur Sprache, die Eltern seien der pietistischen Überzeugung gewesen, „daß des Menschen Wille von Natur und Grund aus böse sei und daß dieser Wille also erst gebrochen werden müsse, ehe der Mensch in Gottes Liebe … das Heil erlangen könne“ (S. 94). Der Satz suggeriert eine Lösung des Problems, die es in dieser Eindimensionalität nicht gibt. Die schlichte Gegenposition, der Mensch sei von Natur aus gut, hat sich immer wieder als Wunschdenken erwiesen. Eine solche Regression in die naiven Anfänge der Aufklärung steht der Pädagogik schlecht an. Versteht man dagegen den „bösen“ Willen als erlösungsbedürftigen Willen, kommt man dem Menschenbild der Reformatoren, das vom Pietismus zwar gemeint, aber nicht immer getroffen wurde, auf die Spur. Die Rede von der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen ist, wenn sie ohne Frömmelei geschieht, eine ideologiekritische Rede, ein Antidoton gegen jeglichen säkularen oder religiösen Triumphalismus. Hesse selbst hat etwas davon gespürt, als er 1934 schrieb: „Die Pietistensprache schmeckt mir auch heute noch nicht, aber … einige Typen, wie Bengel, sind echte Weise und Verwandelte gewesen. Dabei ist es mir eine gewisse Freude zu sehen, wie diese dickköpfigen Schwabenchristen damals aller Glätte und Vernünftigkeit der Aufklärungszeit widerstanden haben, sie sind die einzigen Theologen jener Zeit, die man noch lesen kann“ (S. 242 f.). Joachim Ernst Berendt (zitiert bei Hilbert, S. 181–183) ist beeindruckt von der Herzlichkeit und Wärme, welche die elterlichen Briefe der Krisenzeit durchzieht – „in ihrer Liebeskraft überzeugender als alles, was Hermann damals geschrieben hat … Je näher man sich die Geschichte dieser Jugend ansieht, um so deutlicher wird: Hermann Hesse hat genau die Kindheit gehabt, die er brauchte, um der werden zu können, der er geworden ist. Er hat genau die Eltern gehabt, die dafür nötig waren. Er hätte ihnen dankbar sein müssen – und ist das ja schließlich auch geworden.“ Dieter Ising Quellenangabe: Blätter für württembergische Kirchengeschichte, Jg. 107 (2007), S. 342–343. MATTHIAS HILBERT, Hermann Hesse und sein Elternhaus – zwischen Rebellion und Liebe. Eine biographische Spurensuche. Stuttgart: Calwer Verlag 2005, 292 S. Die Online-Bestellung ist hier möglich: ISBN 3-7668-3972-1