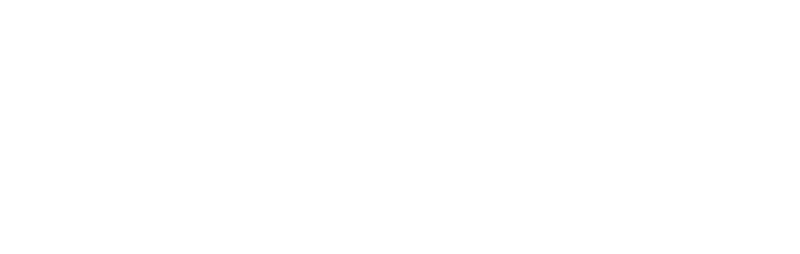Keine Anzeichen von „Verknulpung“ – Hesse-Stipendiat Dr. Andreas Maier las im Calwer Hesse-Museum
Meldung vom 02.08.2012


„Nicht Gerbersau, sondern Wetterau – nicht Hesse, sondern Hessen.“ So führte Susanne Völker, Leiterin der Calwer Museen, in die Lesung mit Hesse-Stipendiat Dr. Andreas Maier ein. Und der zeigte sich im Gespräch mit Literatur-Pädagoge Herbert Schnierle-Lutz wunderbar selbstironisch. Seinen Calw-Aufenthalt empfindet er als „ungeheuer erholsam – Wohnung ruhig, Marktplatz ruhig.“ „Ich kenne Hesse weitaus länger als Calw“, machte Andreas Maier gleicht eingangs deutlich. Die Stadt habe ja auch „eine poetisch idyllische Spur“ in seinem Werk hinterlassen, „eine auf ewig verlorene Gegenutopie.“ Im Übrigen finde er es „wunderbar, dass hier alles so fußläufig“ sei. Gleichwohl nimmt der Hesse-Stipendiat Calw als „alles andere als ein Fachwerkidyll“ wahr, in dem Touristen nach seiner Beobachtung „kaum länger als eine Stunde“ verweilen. Als „ein leichtes, sanftes Dahinsterben“ umschreibt er seine Eindrücke. „Die Heimat ist das, was ständig verlorengeht“, formuliert Dr. Maier, der keinesfalls als Heimatdichter tituliert werden will, nur weil er mal ein Essay zum Thema verfasst hat. Gleichwohl umkreist seine Arbeit dieses Thema, denn „um die Welt zu verstehen, musst du dich erst mal selbst verstehen.“ Wie auch er selbst in seiner frühen Kindheit „zeichnen sich die Protagonisten der ersten Romane dadurch aus, dass sie geschwiegen haben. Im Calwer Hermann-Hesse-Museum las Maier nun aus „Das Haus“, in dem er seinen Erfolgsroman „Das Zimmer“ fortsetzt. Das der Wetterau gewidmete Opus unter dem Arbeitstitel „Ortsumgehung“ ist auf elf Bände angelegt, aktuell arbeitet Maier am dritten Buch „Die Straße“. Bewundernswert präzise nähert sich der Doktor der Philosophie seinen ersten vagen Kindheitserinnerungen in Südhessen an; man ahnt, wie viel Recherche dahintersteckt. „Wir bekommen unsere Kindheit vorerzählt. Man kann zumindest diese Atmosphäre für sich erarbeiten“, beschreibt der Hesse-Stipendiat später seine Vorgehensweise, die immer wieder an Peter Kurzeck erinnert, auch er einst Stipendiat der Calwer Hesse-Stiftung. Die frühe Sprachlosigkeit – der kleine Andreas zeigte nur auf die Dinge, ohne sie zu benennen - macht Maier mit Sätzen wie „dieses wortlose Deuten muss meine Eltern nachhaltig verstört haben“ deutlich. Der erste Kindergartenbesuch ist dann „der erste wirkliche datierbare Tag in meiner Zeitrechnung. Ich war zum ersten Mal unter Menschen und allein. Vor meinen Augen verwandelten sich die Kinder in Handlungsautomaten.“ Maier begibt sich auf die Blickebene des Knaben, bekennt aber in der Diskussion nach der Lesung auf Nachfrage, einen „eigenartigen“ Erzähler konstruiert zuhaben, der gleichwohl „schon etwas mit mir zu tun hat.“ Authentisch folglich auch die Erinnerungen ans Tischgebet, „vorgetragen in jener düsteren Monotonie, die mir stets Schauer über den Rücken jagte. Als gingen sie in diesem einen Moment des Betens ihrer Person verlustig.“ Das Abendessen als schlimmste Stunde des Tages. Heute freilich sei ihm „das Unerträglichste von damals“, das Beten durchaus wichtig. Dass schlussendlich „nach langem ziel- und sinnlos vor sich hin Studieren“ etwas aus ihm geworden, er von den Geschwistern „bei weitem der Erfolgreichste“ sei, habe man im Elternhaus lange nicht gewürdigt. Mit 15 erst sei er mit „so etwas wie“ Kunst und Kultur in Berührung gekommen. Und dass er schon vor der Schule lesen konnte, „das hing mit Asterix zusammen.“ Dass Dr. Andreas Maier, wie er selbst am Beginn der Veranstaltung angesichts eines in letzter Minute besorgten Grünen Veltliners äußerte, „an zunehmender Verknulpung“ leidet, dafür erbrachte diese Lesung indes keinen Beleg. Die Besucher im Calwer Hesse-Museum erlebten einmal mehr einen Schreibgroßmeister, voller Ironie und zugleich Wärme dem skurrilen Personal seiner meisterhaften und oft erst auf den zweiten Blick tiefgründigen Aufzeichnungen gegenüber. Text und Bild: Andreas Laich